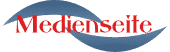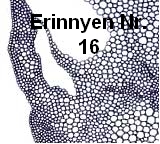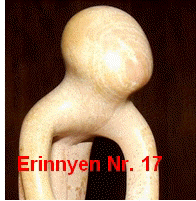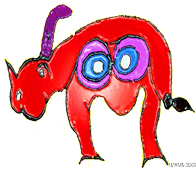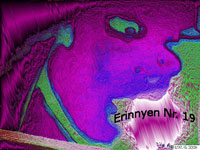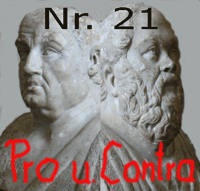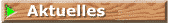



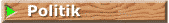
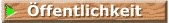


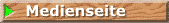





|
Vernunft und Anti-Vernunft
Kritische Anmerkungen zu Hendrik Wallat und seine
„Kritischen Anmerkungen zu Karl Heinz Haag“
(www.kritiknetz.de)
(Erster Teil)
Einleitung
Zum Essay gegen Karl Heinz Haag. Die biographische Mode
Was ist Metaphysik und reines Denken?
Wallat als Apologet von Nietzsches Anrivernunft
(Zweiter Teil)
Anti-Vernunft der reaktionären Philosophie
Die materiellen Bedingungen der Ideologie und der Mystizismus. Sachliche Widersprüche in der Produktionsweise und das ideologische und irrationale Bewusstsein
Zum Schluss
Literatur

Einleitung
Hendrik Wallat hat auf kritiknetz.de eine Rezension bzw. einen Essay veröffentlicht mit dem Titel: „Kritische Theorie als Metaphysik? Kritische Anmerkungen zu Karl Heinz Haag“. Der erste Teil ist eine Rezension des von Peter Kern herausgegebenen Buches “Kritische Theorie als Metaphysik“ – ohne Fragezeichen!, das Resultate eines Symposiums zu Ehren Haags an der Goethe-Universität Frankfurt/Main von 2024 enthält.
Zur Rezension der Buchbeiträge will ich nichts sagen, weil ich sie noch nicht gelesen habe. Aber über Wallats Essay zu Haag muss ich mich äußern, zumal er meine Kritik an Haags theologischer Wendung zustimmend und ausführlich zitiert.
Auffällig ist in diesem Rezensionsteil, dass Wallat weniger Argumente bringt, sondern stattdessen viel bewertet („luzide“ dargestellt / „konzis“ den Kerngedanken rekonstruiert). Andererseits bemüht er viele philosophische Schlagworte wie: er betont die „Einschätzung von Hegels absoluten Idealismus als Nihilismus“, „der sich in Teilen auch in Marx‘ materialistischer Dialektik forterbe“ (S. 6). Verstehe das wer will. Solche Einschätzungen bedienen Vorurteile, verstellen den geistigen Blick auf die konkreten Einsichten und erinnern in ihrer Methode an den Kampf der stalinistischen Weltanschauung, die alles einteilt in „materialistisch“ und „idealistisch“, für die Partei nützlich oder schädlich.
Zum Essay gegen Karl Heinz Haag. Die biografische Mode bei Wallat
Zum Essay über Haag: Bereits das Fragezeichen in seinem Titel verweist auf das Problematische seiner Meinung. Jede Äußerung „Kritischer Theoretiker“ beinhaltet metaphysische Implikationen. Allein schon die Logik, um den Text verständlich zu machen, ist metaphysisch, oder platt ausgedrückt: Urteile und Schlüsse laufen nicht in der Natur herum, sind also meta physica (nach der Physik), ebenso die philosophischen Kategorien wie Grund und Folge usw. Man kann sich nur dieser metaphysischen Implikationen bewusst sein, sie als rational begründete anwenden – oder unbewusst mit ihnen hantieren und insofern eine irrationale Lücke in seinem Denken haben. Das rhetorische Fragezeichen im Titel von Wallat deutet eher auf letzteres hin. Auch seine gelegentliche Gleichsetzung kritischer Metaphysik, zu dem Haag einen wichtigen Beitrag geleistet hat, mit dessen theologischer Verirrung, wertet Metaphysik generell ab.
Philosophie ist unter anderen die Wissenschaft von den Prinzipien des Ganzen, soweit wir dies erkennen können. Bricht man einen Teil heraus (wie z. B. die Metaphysik), um dort sein subjektives Spiel zu treiben, dann tendiert Philosophie zu Spezialwissenschaft ohne Bezug zum Ganzen, letztlich zur Ideologie, die ein Denkgebäude zur Rechtfertigung von Herrschaft errichtet oder auch zur „Zerstörung der Vernunft“ (Lukács), unser oberstes Erkenntnisvermögen, beiträgt, um jede Kritik an Herrschaft als bloß zufällige Meinung zu neutralisieren.
Indem Wallat zu Recht die theologische Wende von Haag kritisiert als Mystizismus, bereitet er mit seiner Anti-Vernunft eine neue Mystifizierung des Denkens vor. Diese erscheint zunächst als biographische Reduktion.
Wallat schreibt: „Haag selbst verstand seine Philosophie als strengste Suche nach objektiver Wahrheit, die alles Persönliche und Subjektive von sich abzustreifen hätte. „(...) Seinen Studenten riet er sogar dringend, dass in ihren wissenschaftlichen Arbeiten das Wort ‚Ich‘ gar nicht vorkommen dürfe“ (S. 12). Wallat kommentiert diese Auffassung: „Ohne diesem Anspruch mit einem Psychologismus zu begegnen, der die objektive Geltung des Arguments durch dessen subjektive Genese relativiert, kommt man dennoch nicht umhin, gerade einem solchen Unternehmen, das die gesamte Denk- und Lebenspraxis der Beantwortung einer einzigen (?) Frage unterwirft, als von einem zutiefst existentiellen Bedürfnis angetrieben zu deuten.“ (S. 12) An anderer Stelle spricht Wallat von „(meta-)physischen Bedürfnissen“ als Voraussetzung (S. 14).
Das sind Überlegungen, die irrationale Momente enthalten. Subjekt (das Zugrundeliegende) der Wissenschaft ist nach der traditionellen Metaphysik das ontologisch Seiende. Nach der nominalistischen Kritik daran, wurde das Subjekt das menschliche Bewusstsein – dessen Rationalität kann aber nicht das einzelne Ich sein, sondern allein die Menschheit. Da es diese als reale noch nicht gibt, kann „Menschheit“ heute nur das Ideal der Menschheit sein, wie es sich im avancierten Stand der Vernunft ausdrückt, bei Kant als transzendentales Ideal. Dagegen hat z. B. Hobbes die Macht des „Leviathans“ als Subjekt gesetzt, ähnlich auch Nietzsche, allerdings aus der Perspektive des fiktiven Herrn als Übermenschen. Der Existenzialismus hat das individuelle Bewusstsein zum Subjekt gemacht, Sartre hat sogar eine Ethik entwickelt, die auf einer individuellen Entscheidung beruht. In dieser Tradition steht Wallats Subjektivierung des wissenschaftlichen Denkens. Dagegen steht die kritische Theorie seit Kant, der auch Marx folgt (MEW 42, S. 20), die beide von dem Ideal der Menschheit als Subjekt der Wissenschaft ausgehen.
Wenn ich einmal auf diese Subjektivierung von Wallat positiv eingehen darf, dann geht mein Unbehagen an der Ich-bezogenen Darstellung von Wallat und mein subjektives Festhalten an einer objektiven Vernunft auf meine Erfahrung in der DDR zurück. Als die Stasi mir mein (proto-)kritisches Bewusstsein in tagelangen und auch nächtlichen Verhören austreiben, quasi die Black box für sie leeren und neu füllen („umerziehen“) wollte, hat mich mein kritisches Realitätsbewusstsein, auch in der DDR Objekt der Ausbeutung zu sein, davor bewahrt, umzufallen, zumal ich das „Kapital“ von Marx damals bereits, wenn auch nur oberflächlich, gelesen hatte. Darin einen Grund für mein Streben nach objektiver Wahrheit zu sehen, könnte einige Berechtigung haben, aber nicht für die Resultate meines Denkens. Diese sind als Ethik an die Notwendigkeit des Überlebens der Spezies Mensch gebunden, nicht an individuelle Erlebnisse.
In diesem Buch von Marx kommt – soweit ich sehe – außer in den Vorworten das Ich des Autors, so wie es Haag auch von seinen Studenten forderte, nicht vor. Er will objektive Wissenschaft betreiben, wie später dann auch Karl Heinz Haag. Dass auch große Denker Fehler machen, schiefe Deutungen liefern oder sich einfach geirrt haben, trifft auf Marx ebenso zu wie auf Haags theologisches Abgleiten in seinem letzten Buch. Seine Wahrheiten gilt es jedoch in einem entwickelteren Stand der Vernunft aufzuheben. Die abstrakte Negation der negativen Metaphysik von Haag macht dies jedoch unmöglich.
Was ist Metaphysik und reines Denken?
Das jedoch vermisse ich bei Wallat, wenn er tendenziell die negative Metaphysik mit der theologisierenden Metaphysik von Haag konfundiert. Überhaupt ist es in der „Kritischen Theorie“ üblich, sich gegen das reine Denken zu wenden, es als Metaphysik negativ zu konnotieren. „Rein“ ist nicht einfach ein Gegensatz zur Empirie oder zur konkreten Geschichte. So schreibt Wallat pauschal: „Philosophie ohne Versenkung in die konkrete Geschichte ist Ideologie.“ (S. 9) Voraussetzung der kritischen Wende in der Metaphysik ist Kants Gedanke, nach den Bedingungen der Möglichkeit der modernen Naturwissenschaft (Newton) zu fragen. Diese sind in sich stimmig, stimmen mit den anderen Wissenschaften wie Mathematik und Astronomie zusammen und sie sind – Kant ergänzend – auch Bedingungen der Möglichkeit der modernen Industriegesellschaft. Sie erfüllen dadurch auch das praktische Wahrheitskriterium. Sind also die modernen Naturwissenschaften wahr, dann müssen also auch ihre Kategorien (wie Ursache und Wirkung, Qualität, Quantität usw.) wahr sein. Deren Begründung und Reflexion nennt Kant transzendental, die Logik und Kategorienlehre ist als kritische transzendentale Metaphysik dann a priori, universal und notwendig geltend. Die Metaphysik wird negativ, wenn nach dem ontologischen Grund unserer Bestimmungen gefragt wird, weil wir keinen direkten Zugang zur ontologischen Sphäre, keine intentio recta haben. Aversionen gegen reine Bestimmungen, die doch nur sind durch Abstraktion von konkreten Bestimmungen, zu haben, beruht entweder auf Unkenntnis der philosophischen Tradition, ist naives Bewusstsein oder gar ein Aspekt der gewollten Zerstörung der Vernunft.
Das reine Denken ist auch in der Moralphilosophie praktisch notwendig. Denn wenn Moral auf dem Bedürfnis beruht, dann haben wir so viele Moralvorstellungen wie es Individuen mit ihrem Nichtidentischen gibt. Das muss abstrakt gesehen zum Kampf eines jeden gegen jeden führen. Auch darf Moral nicht von irgendeinem Interesse, dem Bedürfnis ins Politische transformiert, abhängen, denn sonst, so argumentiert Kant, bedürfe es noch ein (Allgemein-)Interesse, das die Interessenmoral auf ihre reine Allgemeingültigkeit einschränkte. Partikulare Moral aber führt, wie die Geschichte der Neuzeit zeigt, zum Bürgerkrieg, zum Weltkrieg und evtl. zukünftig zur Selbstvernichtung der Spezies Mensch.
Wenn Wallat die Versenkung der Philosophie in die konkrete Geschichte fordert, dann wird der Geschichtsbezug irrational. Typisch dafür sind die jungen Marx und Engels, die in ihren „revoltierenden Nominalismus“ schreiben: „Der Zustand Deutschlands am Ende des vorigen Jahrhunderts spiegelt sich vollständig ab in Kants ‚Critik der practischen Vernunft‘. (...) Kant beruhigte sich bei dem bloßen ‚guten Willen‘, selbst wenn er ohne alles Resultat bleibt“ (was dem Text von Kant widerspricht, BG) (...) Dieser gute Wille Kants entspricht vollständig der Ohnmacht, Gedrücktheit und Misère der deutschen Bürger, deren kleinliche Interessen nie fähig waren, sich zu gemeinschaftlichen, nationalen Interessen einer Klasse zu entwickeln.“ (Marx/Engels: deutsche Ideologie, MEW 3, S. 176 f.) Stillschweigend hat dann der reife Marx den Maßstab des guten Willens, das moralische Gesetz, zum Maß seiner Kapitalanalyse gemacht, gerade weil er zunächst rein entwickelt wurde (vgl. u. a. K I, S. 603 u. 621) (siehe auch unten das Zitat von Haag).
Und in der Negt-Schule wiederholt sich diese platte Historisierung und die biographische Mode. So in dem Abdruck seiner Vorlesungen von 1974/75. Er zählt vier Momente einer Biographie auf, die den Geist bestimmen sollen (Negt: Moral und Gesellschaft: Immanuel Kant, S. 167 ff.), sagt aber, dass dieser Zusammenhang von Biographie und Theorie „nichts voraussagen kann“ (a. a. O., S. 170). Aber den immanenten Gang der Argumentation wertet er mit Adorno ab als „Fundierungswahn“ (S. 312) (und Wallat übernimmt unkritisch diesen Begriff in seinem Nachwort zu Negt, a. a. O., S. 493). Was dann herauskommt, sind solche Plattitüden wie: Im kantischen Begriff „Gewühle von Erscheinungen“ und seiner Bewältigung „artikuliert sich das Sicherheitsbedürfnis des Bürgers Kant“ (S. 335). Für die Wissenschaft von der Erkenntnis ist solch eine Aussage, ob wahr oder falsch, sinnlos. Ich erwähne Negt, weil Wallat für dieses Buch ein affirmatives Nachwort geschrieben hat und diese Soziologisierung von Allgemeinbegriffen u. a. auch auf Negt zurückgeht. (Vgl. mein Nachruf zu Negt: http://www.erinnyen.de/aktuelles/aktuell25.html)
Der Zusammenhang von abstrakter Theorie und Geschichte lässt sich erst am Ende des immanenten Ganges der Argumentation aufweisen, Modell dafür gibt z. B. Kuhne in seinem Buch über die Transzendentalphilosophie.
Wallat als Apologet von Nietzsches Antivernunft
Die Aversionen von Wallat gegen die „strengste Suche nach objektiver Wahrheit“ von Haag (S. 12), findet in Nietzsche einen Geistesverwandten. Für Nietzsche liegt der „Wert der Welt in unserer Interpretation“ (Nietzsche: Nachlaß, S. 89). Voraussetzung dafür ist: „es gibt keine Wahrheit“ (ebd.). Wenn es keine Wahrheit gibt, dann sind alle Äußerungen von Nietzsche (und Wallat?) bloß willkürliches Geschwätz und man kann ihnen folgen oder auch nicht. Nun übernimmt Wallat nicht einfach solche Thesen („auch wenn es hier nicht um eine Verteidigung von Nietzsches Philosophie geht“, S. 13), sondern er wendet als rhetorische Methode (wie Hannah Arendt) die indirekte Strategie des kritischen Fragens an, um einen Begriff von objektiver Wahrheit zu destruieren. Es „lässt sich doch die Frage stellen, ob nach Nietzsche überhaupt noch so philosophiert werden kann, wie es Haag tat – und wieso er sich so gar nicht auf Nietzsches Antworten auf denjenigen Nihilismus, den beide Denker im Innersten bewegte, eingelassen hat.“ (S. 13) Das Wallat gerade diesen Aspekt gegen Haag mobilisiert, die Herrschaft affirmierenden aber weglässt (siehe unten), verstärkt seine irrationale Intention.
Nach dem Fehlschlag des sozialistischen Experiments in der Sowjetunion und dem Verfall des „Marxismus“ (so sagt schon Marx: „Ich bin kein Marxist“), suchen kritische Intellektuelle nach neuen Vorbildern, „großen“ Philosophen, autoritären Lehrstuhlinhabern, an die sie sich geistig anlehnen können. Da kommt ihnen Nietzsche mit seiner psychologistischen und sinnlich-empiristischen Position gerade recht. Nietzsche entwickelt ein feines Gespür für die Probleme seiner Zeit, die moralische Heuchelei und die gesellschaftliche Dekadenz des Bürgertums. „Was bedeutet Nihilismus? – Daß die obersten Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel. Es fehlt die Antwort auf das ‚Wozu?‘“. (Nietzsche: Nachlaß, S. 149) Nach Marx ist die kapitalistische Produktion ebenfalls eine ohne moralisch gerechtfertigtes Ziel: „Produktion um der Produktion willen“ (MEW 23, K I, S. 621). Aber während Marx den Grund erklärt, der dem Kapitalismus immanente Zwang zur Akkumulation des Kapitals, so moralisiert Nietzsche diese Tatsache bloß als Nihilismus. Während Marx darin das Potenzial einer höher entwickelten herrschaftsfreien Gesellschaft erkennt, steigert sich Nietzsche in eine reaktionäre Utopie, die Herrschaft auf ewig (tausend Jahre) perpetuieren will. „Es braucht die Gegnerschaft der Menge, der ‚Nivellierten‘, das Distanz-Gefühl im Vergleich zu ihnen; er steht auf ihnen, er lebt von ihnen. Diese höhere Form des Aristokratismus ist die der Zukunft. – Moralisch geredet, stellt jene Gesamt-Maschinerie, die Solidarität aller Räder, ein Maximum in der Ausbeutung der Menschen dar: aber sie setzt solche voraus, derentwegen diese Ausbeutung Sinn hat.“ (Nietzsche: Nachlaß, S. 221) Nietzsches Utopie besagt, dass er eine zukünftige „Herren-Rasse“ heranzüchten will, die auf der gewaltsamen Ausbeutung der Menschen, der Nivellierten, der Arbeitermasse beruht. (A. a. O., S. 96 f.)
Nietzsche bleibt aufgrund seiner platten Erkenntnisvorstellung an der Oberfläche der Erscheinungen. Besonders peinlich ist es dann, wenn Theoretiker wie Wallat gerade Nietzsches Vernunftkritik dezisionistisch übernehmen. „Nietzsches genealogischer und triebphysiologischer Generalangriff auf den unreflektierten Willen zur Wahrheit als Lebensmovens der Philosophen, bezeichnet den größten Gegenschlag zu Haags Verständnis von Philosophie als von jeder Individualität abstrahierende Suche nach der objektiven Wahrheit. Letzteres ist für Nietzsche eine gewaltige Täuschung des Philosophen, der sich nicht einmal die Frage zu stellen scheint, warum er überhaupt Wahrheit und ‚nicht lieber Unwahrheit‘ begehrt. Was der Grund dieser Wertschätzung ist, bewegt sich außerhalb der Reichweite der Reflexion. Er ist schlicht dogmatisch gesetzt und als solche unaufgeklärte Voraussetzung für Nietzsche ein unbewusstes Vorurteil“. (S. 13) (Das Haag-Zitat am Schluss zeigt das Gegenteil!) Klarer kann man die Anti-Vernunft nicht präsentieren, und zugleich versteckt sich Wallat hinter solchen Aussagen Nietzsches in seiner indirekten Zerstörung der Vernunft im öffentlichen Bewusstsein der Kritischen Theoretiker. Und als Beleg für Wallats Anti-Vernunft führt er das Abgleiten von Haag ins Theologische an, als ob notwendig aus dem Streben nach objektiver Wahrheit theologische Metaphysik folgen würde. Da es keine objektive Vernunft für Wallat gibt, alles nur subjektivistisch biographisch ist, kann er sagen: „Noch die abstrakteste Spekulation, die, von jeder individuellen Erfahrung absehend, sich der objektiven Wahrheit verschreibt, hat am Ende ein Subjekt und dessen (meta-)physische Bedürfnisse zur Voraussetzung.“ (S. 14) Hier wird schlicht der individuelle Antrieb zur Forschung mit dem objektiven Resultat, wenn es ein solches gibt, konfundiert. Es existiert nur subjektive Vernunft, die Menschheit als objektives Subjekt existiert nicht, ein halbes Jahrtausend philosophisches Denken wird mit einem Federstrich eliminiert.
Wallat stellt sich mit solchen Aussagen in eine Tradition, die von Nietzsche, Heidegger und Arendt über Carl Schmitt bis zu den Theoretikern der Neuen Rechten reicht.
Der Irrationalismus von Nietzsche, seine Vernunftfeindschaft, die aus seinem sinnlichen Empirismus resultiert, seine Herrschaftsideologie und seine spätere Funktionalisierung als Stichwortgeber für Hitlers Weltanschauung kann man nicht ignorieren, wenn man zufällig treffende kritische Erkenntnisse von ihm ohne weiteres verwendet. Wieso viele kritische Intellektuelle von Nietzsche noch nach 1945 fasziniert sind, hat Lukács versucht zu erklären.
Bei den sensiblen Intellektuellen wird die Einsicht in die Dekadenz der Gesellschaft zum Problem, aber auch der Wunsch, sie zu überwinden. Das macht die Philosophie von Nietzsche für viele kritische Intellektuelle so anfällig. „Der soziale Auftrag, den Nietzsches Philosophie erfüllt, besteht darin, diesen Typus der bürgerlichen Intelligenz zu ‚retten‘ zu ‚erlösen‘, ihm einen Weg zu weisen, der jeden Bruch, ja jede ernsthafte Spannung mit der Bourgeoisie überflüssig macht; einen Weg, auf dem das angenehme moralische Gefühl, ein Rebell zu sein, weiter bestehenbleiben kann, sogar vertieft wird, indem der ‚oberflächlichen‘, ‚äußerlichen‘ sozialen Revolution eine ‚gründlichere‘, ‚kosmisch-biologische‘ lockend gegenüber gestellt wird.“ (Lukács: Zerstörung der Vernunft, S. 277) Diese Faszination hat Nietzsche besonders wieder nach 1989, viele ehemals kritische Intellektuelle wenden sich von konkreten Alternativen zur Herrschaft des Kapitals ab und suchen ihren Zweck in Kulturkritik. „Jedoch gerade diese Verknüpfung von brutal ordinärem Antisozialismus mit einer raffinierten, geistreichen, zuweilen sogar richtigen Kultur- und Kunstkritik (man denke an die Kritik Wagners, des Naturalismus usw.) macht seine Inhalte und Darstellungsweisen so verführerisch für die imperialistische Intelligenz.“ (A. a. O., S. 277) Mag man sich über den platt materialistischen Begriff „imperialistische Intelligenz“ streiten, so ist die Faszination von Nietzsche seit dem 19. Jahrhundert auf Intellektuelle nicht bestreitbar (vgl. a. a. O., S. 277 ff.), und bis heute, wie Wallat zeigt.
Zurück zum Anfang
|
Weitere Internetseiten und unsere Internetpräsenz im Detail:

Audios, Fotos und Videos:
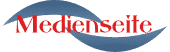
Die letzten Ausgaben der Erinnyen können Sie kostenlos einsehen oder herunterladen:

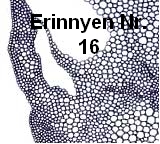
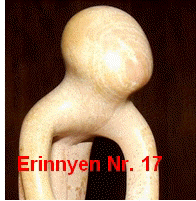
Erinnyen Nr. 18
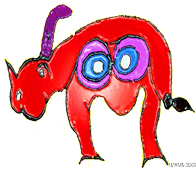
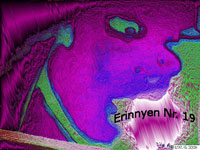

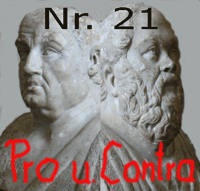
Erinnyen Nr. 22

Erinnyen Nr. 23

Nachrichten aus dem beschädigten Leben:

Unsere Zeitschrift für materialistische Ethik:

Unsere Internetkurse zur Einführung in die Philosophie:

Unsere Selbstdarstellung in Englisch:

Die Privatseite unseres Redakteurs und Vereinsvorsitzenden:

Unser Internetbuchladen:



|