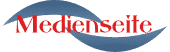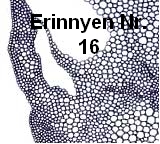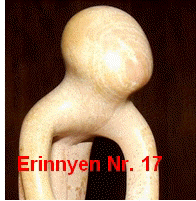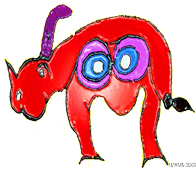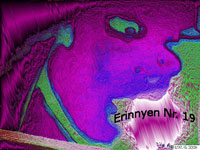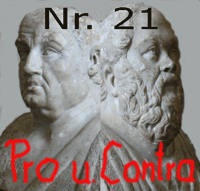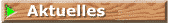



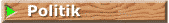
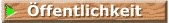


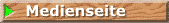





|
Zweiter Teil von
Vernunf und Antivernunft
Die Anti-Vernunft der reaktionären Philosophie
Wenn man nicht mehr an objektive Vernunft und daraus begründete universale Wahrheit gebunden ist, dann kann man alles behaupten, von falschen Identitäten, partikularen Bezügen wie das Vaterland, die Aufklärung bekämpfen und das Abendland retten oder gar seine Studenten auffordern, der Stimme des Seins zu folgen, die 1933 für Heidegger der Führer verkörpert. Deshalb rechtfertigen reaktionäre Philosophen wie Peter Trawny die Strategie der Anti-Vernunft. In seiner Rezension von Emmanuel Faye: „Heidegger und Arendt“, geht Trawny, ein Herausgeber von Heideggers Schriften, gegenaufklärerisch wie Heidegger und Arendt von der Destruktion der Vernunft bzw. ihres möglichen avancierten Standes aus, indem er skeptizistisch vom unbegrenzten Fallibilismus, auf Popper u. a. zurückgehende „Zerstörung“ der Vernunft, ausgeht. Trawny schreibt: „Vor allem aber setzt Faye das Denken der Aufklärung, die Philosophie der universellen Vernunft als nicht mehr hinterfragbar voraus. Daraus bezieht er gültige Evidenzen, vor deren Hintergrund er alles bewertet und verurteilt. Solche Evidenzen aber gibt es in der Philosophie nicht. Die Vernunft muss sich stets argumentativ bewegen, um nicht selbst zu einem zerstörerischen Dogma zu versteinern. Kants Denken liefert keine unumstösslichen Wahrheiten, wie Faye voraussetzt. Es bietet lediglich Einsichten, die ihren prekären Charakter nicht verleugnen.“ (Trawny, letzte Seite seiner Rezension in der NZZ, vom 3.7.24) Nun wird hier die Aufklärung kritisiert, ohne wirklich zu argumentieren, völlig unkonkret. Wenn Vernunft sich „argumentativ bewegen“ müsse, dann ist das ihr normales Geschäft, seine Rede aber, „um nicht selbst zu einem zerstörerischen Dogma zu versteinern“, will darauf hinaus, dass es keine Wahrheiten der Vernunft gibt, denn „Dogma“ heißt Lehre, also gültige Wahrheit, die es aber als „unumstössliche“ in diesem Fallibilismus und Skeptizismus nicht gibt. Dann ist aber auch die Wahrheit, dass es keine unumstößliche Wahrheit gebe, keine sichere Wahrheit. Wenn sichere Wahrheiten sich selbst zerstören, dann ist eine philosophische Entwicklung zur Wahrheit nicht mehr möglich. Das Denken müsste immer wieder bei den Vorsokratikern anfangen. Was zerstört ist, kann nicht in einen neuen Stand der Vernunft eingehen – gegen Hegels These von der bestimmten Negation, welche die wahren Momente aufbewahrt und aufhebt in dem neuen Stand. Fallibilismus und Skeptizismus ist aber kein neuer Stand der Vernunft angesichts des heute aufgehäuften Wissens, das nicht ohne Vernunft zu haben ist.
Bei Trawny wird also, wie es auch Heidegger und Arendt machen, die Vernunft ohne Argumente pauschal denunziert oder raffinierter wie es schon bei Heidegger heißt: „dekomponiert“. Entsprechend ist auch seine „Rezension“ angelegt. Trawny gibt einige Thesen des Buches von Faye im Konjunktiv I wieder und bestreitet sie meist gegen die Belege und kritischen Interpretationen dieser durch Faye.
Bei den Theoretikern der Neuen Rechten äußerst sich die Beliebigkeit vernunftlosen Denkens, der Anti-Vernunft, im „Kampf gegen den Universalismus der Aufklärung“ (Weiß: autoritäre Revolte, S. 41) Demnach kann es keine Menschenrechte, kein Völkerrecht und keine rechtliche Gleichheit der Menschen geben. (Vgl. a. a. O., S. 210, auch 203, 227) Die Auswirkungen dieser Ideologie sind der brutale Terror der Herrenmenschen über die Herdentiere, wie sie bereits Nietzsche konzipiert hat.
Die materiellen Bedingungen der Ideologie und des Mystizismus
Sachliche Widersprüche in der Produktionsweise und
das ideologische und irrationale Bewusstsein
Wenn „materialistisch“ überhaupt eine Bedeutung hat, dann die, auf die materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen einzugehen, die irrationales Denken begünstigen oder gar provozieren, allerdings ohne in die biographische Mode zu verfallen. Ein Modell hat Marx im Kapital (MEW 25, K III) in Bezug auf die Vulgärökonomie geliefert.
Ein solcher sachlicher Widerspruch ist die Geldrente, die auf ein bestimmtes Stück Boden vom Grundeigentümer einkassiert wird. Denn Geld als Ausdruck des Wertes, und Boden, als ein Stück Natur sind „inkommensurable Größen. „(...) ein bestimmter Gebrauchswert, Bodenstück von soundso viel Quadratfuß auf der einen Seite, und Wert, speziell Mehrwert auf der andern.“ (Marx K III, S. 787) Ökonomischer Wert ist die Durchschnittsarbeitszeit, die in einem Produkt steckt, sie ist eine gesellschaftliche Größe, Boden dagegen ein Naturding. Marx kommentiert diesen Widerspruch in Bezug auf das Bewusstsein der ökonomischen Akteure:
Der Widerspruch „drückt dies in der Tat nichts aus, als daß unter den gegebnen Verhältnissen das Eigentum an den Quatratfüßen Boden den Grundeigentümer befähigt, ein bestimmtes Quantum unbezahlter Arbeit abzufangen, die das in den Quatratfüßen wie ein Schwein in den Kartoffeln wühlende Kapital (...) realisiert hat. Prima facie ist der Ausdruck aber derselbe, als wollte man vom Verhältnis einer Fünfpfundnote zum Durchmesser der Erde sprechen.“ (Ebd.)
Die ökonomischen Akteure nehmen diesen und andere Widersprüche nicht zur Kenntnis und agieren blind in diesen Widersprüchen. Solche Widersprüche bestimmen die kapitalistische Produktionsweise insgesamt.
„Die Vermittlungen der irrationalen Formen, worin bestimmte ökonomische Verhältnisse erscheinen und sich praktisch zusammenfassen, gehn die praktischen Träger dieser Verhältnisse in ihrem Handel und Wandel jedoch nichts an; und da sie gewohnt sind, sich darin zu bewegen, findet ihr Verstand nicht im geringsten Anstoß daran. Ein vollkommner Widerspruch hat durchaus nichts Geheimnisvolles für sie. In den dem innern Zusammenhang entfremdeten und, für sich isoliert genommen, abgeschmackten Erscheinungsformen fühlen sie sich ebenfalls so zu Haus wie ein Fisch im Wasser.“ (Ebd.) Ein solches Herumwühlen in den Erscheinungen bzw. im Schein, und – theoretisch – ohne den Unterschied von Wesen und Erscheinung zu machen, d. h. heißt hier die Werttheorie zu missachten, führt zu ideologischen Gestalten des Bewusstseins. Dieses Bewusstsein bezeichnet Marx als „Vulgärökonomie“. (Siehe unten)
Weitere Widersprüche sind die Mystifikationen, die gesellschaftliche Verhältnisse als stoffliche Elemente des Reichtums, als Eigenschaften der Dinge erscheinen lassen (Warenfetisch, Geldfetisch); und zugleich die lebendige Arbeitskraft als dingliche abzuqualifizieren. Es herrscht eine Personifizierung der Sachen und eine Versachlichung der Produktionsagenten (Verdinglichung), die sich zur „Religion des Alltagslebens“ verfestigt hat. Dadurch bleibt der bürgerliche Standpunkt in der „Welt des Scheins“ befangen.
Weiter Widersprüche sind: Die Mechanismen, welche die kapitalistische Produktionsweise beherrschen, wie z. B. der Zwang zur Kapitalakkumulation als oberster Zweck, erscheinen als Regel in der Regellosigkeit (Anarchie des Marktes). In der Verwandlung des Mehrwerts in Durchschnittsprofit ist dessen Herkunft nicht mehr für das oberflächliche Bewusstsein erkennbar. So scheint der Durchschnittsprofit, der auf den Kostpreis aufgeschlagen wird, mysteriöses Anhängsel zu sein, während er doch gesamtgesellschaftlich den Mehrwert beinhaltet, den die Lohnabhängigen produzieren. So erscheint der Zins, den das Kapital einstreicht, bloß weil es verliehen wurde, aus einer mysteriösen, unbestimmten Quelle zu stammen. Das ist nach Marx die Vollendung des Kapitalfetisch, obwohl die Analyse zeigen kann, dass er Resultat der Arbeit der Masse der Mehrwertproduzenten ist, die ihn kostenlos erzeugen (Ausbeutung). In dieser Ausbeutung besteht auch der zentrale gesellschaftliche Widerspruch zwischen Kapitaleigner und Arbeiterklasse.
„Wenn das Kapital ursprünglich, auf der Oberfläche der Zirkulation, erschien als Kaptialfetisch, werterzeugender Wert, so stellt es sich jetzt wieder in der Gestalt des zinstragenden Kapitals als in seiner entfremdetsten und eigentümlichsten Form dar. Weshalb auch die Form: ‚Kapital-Zins‘ als drittes zu ‚Erde-Rente‘ und ‚Arbeit-Arbeitslohn‘ viel konsequenter ist als ‚Kapital-Profit‘, indem im Profit immer noch eine Erinnerung an seinen Ursprung bleibt, die im Zins nicht nur ausgelöscht, sondern in feste gegensätzliche Form zu diesem Ursprung gestellt ist.“ (Marx: K III, S. 837)
Zwischen den Widersprüchen in der Realität und dem Denken und ihren Formen besteht jedoch kein notwendiges Ursache-Wirkungs-Verhältnis, das Denken ist kein Abbild des Seienden (entgegen Lukács), und das Wirkliche determiniert nicht mit Notwendigkeit die begrifflichen Vorstellungen von der Sache. Gegen solche Determination sagt Marx in Bezug auf die Vulgärökonomie: „Dies hindert nicht, daß dieselbe ökonomische Basis – dieselbe den Hauptbedingungen nach – durch zahllos verschiedne empirische Umstände, Naturbedingungen, Racenverhältnisse, von außen wirkende geschichtliche Einflüsse usw. unendliche Variationen und Abstufungen in der Erscheinung zeigen kann, die nur durch Analyse dieser empirisch gegebnen Umstände zu begreifen sind.“ (Marx: K III, S. 800) Und sie erzeugen die anderen Varianten des Vulgärbewusstseins.
Vor allem das, was Marx als Vulgärökonomie bezeichnet, ist direkt von dem Schein dieser Produktionsweise geprägt. „Die Vulgärökonomie tut in der Tat nichts, als die Vorstellungen der in den bürgerlichen Produktionsverhältnissen befangenen Agenten dieser Produktion doktrinär zu verdolmetschen, zu systematisieren und zu apologisieren. Es darf uns also nicht wundernehmen, daß sie gerade in der entfremdeten Erscheinungsform der ökonomischen Verhältnisse, worin diese prima facie abgeschmackt und vollkommene Widersprüche sind – und alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen –, wenn gerade hier die Vulgärökonomie sich vollkommen bei sich selbst fühlt und ihr diese Verhältnisse um so selbstverständlicher erscheinen, je mehr der innere Zusammenhang an ihnen verborgen ist, sie aber der ordinären Vorstellung geläufig sind.“ (Marx: K III, S. 825) Man könnte noch ergänzen: Der platte Utilitarismus in der Ökonomie bestimmt auch die Motive der Ideologien.
Für die geistige Sphäre der kapitalistischen Produktionsweise wirken deren Widersprüche noch sublimer, immer auch in Bezug auf eine Vielfalt an geistigen Einflüssen. Für die Philosophie oder „Weltanschauung“ kommen dann noch die Traditionen hinzu, auf die sich diese Gedankengebäude beziehen oder gegen die sie opponieren, ebenso die geistigen Moden, die durch Publikationsmöglichkeiten und Lehrstühle gefördert werden, vorherrschende Ideologien, die von der bürgerlichen Politik prämiert werden usw.
Da der Mensch auch Reflexionsvermögen hat, einen stabilen Charakter im Geistigen, der an Wahrheit interessiert ist, sich aneignen kann, provozieren die Widersprüche in der Realität auch das Streben, diese zu analysieren und eine Theorie zu entwickeln, die das Wesen der gegenwärtigen Ökonomie und ihrer Gesellschaft analysiert, erkennt und auf praktische Veränderung dringt. Eigentlich war dies der Anspruch der kritischen Theorie einschließlich der „Kritischen Theorie“ als Frankfurter Schule. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und ihrer Glacis wurde der „Marxismus“ (Marx: „Ich bin kein Marxist“) bei vielen, die ihn angehangen haben, unpopulär und sie suchten sich andere Strömungen der Philosophie. Dazu gehört auch der Bezug auf Nietzsches Philosophie, wie er bei Wallat sich zeigt. Schon Lukacs hatte bemerkt: „Nietzsche ist nun als Kulturpsychologe, als Ästhetiker und Moralist vielleicht der geistreichste und vielseitigste Exponent für diese Selbsterkenntnis der Dekadenz.“ (Lukács: Zerstörung der Vernunft, S. 276) Eine Intelligenz, von dem Scheitern einer sozialistischen Revolution enttäuscht, wendet sich, wenn sie nicht gleich ins Lager der herrschenden Klasse umschwenkt, Nietzsche zu.
Gerade Nietzsches Kritik der moralischen Heuchelei, sein raffinierter elitärer Standpunkt, in dem er seine Leser einlädt, teilzunehmen, machen ihn für Kritische Theoretiker so attraktiv. Ich will nicht Motivsuche bei konkreten Intellektuellen machen, auch nicht bei Wallat. Denn die Motive für eine Beschäftigung mit einer Theorie oder ein Thema einzusehen, ist von außen nicht möglich, oft weiß es der Intellektuelle selbst nicht genau. Das wusste bereits der Aufklärer Kant. Was beurteilt werden kann, ist der vorliegende Inhalt der Texte. Darin zeigt sich:
Der metaphysische Grund für diese Oberflächlichkeit liegt in der abstrakten Negation der Metaphysik, sodass es kein Wesen für dieses Denken geben kann. Dadurch bleibt auch der bürgerliche Standpunkt in der sozialen Welt des Scheins befangen. Die gesellschaftliche Verdinglichung wird überspielt durch die Konzentration der existenzialistischen Entscheidung auf die Biographie usw. Das Herumwühlen in den Erscheinungen, wogegen Kant seine Erkenntnisreflexion bemüht, darin fühlt sich die Anti-Vernunft-Fraktion wie Nietzsche, Trawny und Wallat u. a. wohl, da können sie alle Einzelheiten der Biographie bemühen, jeden historischen Fakt aufsammeln, was nichts mit der wissenschaftlichen Allgemeinheit zu tun hat. Aus Theorie wird Belletristik mit abstrakten Begriffen.
Die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise, die auch in der Sozialstruktur und der bürgerlichen Politik bestimmend sind, werden ignoriert oder abgelenkt durch immer detailreichere oberflächliche Erscheinungen („konkret Geschichte“). Im oberflächlichen Bewusstsein wird sich nicht nur eingerichtet, sondern die Vernunft basierten Bestimmungen, die dort hinausführen könnten, werden explizit von Nietzsche (und Wallat) bekämpft. Entsprechend wird alles, was nicht auf der gesellschaftlichen Oberfläche oder der „konkreten Geschichte“ erscheint, ignoriert, tieferes Eindringen in die antagonistische Wirklichkeit als persönliche Beschränktheit und Sturheit interpretiert, wie Nietzsche bei Kant und Wallat bei Haag.
Damit ihr Herumwühlen in den Erscheinungen nicht offenbar wird, verunglimpfen sie die Vernunft und ihren avancierten Stand, der auffordert, zum Wesentlichen vorzudringen. Im Gegensatz zu den platten Vulgärökonomen haben die niveauvollen Denker durchaus Reflexionsvermögen, aber sie setzen es nicht rational ein, sondern subversiv zur Destruktion aller derjenigen, die wirklich kritische Theorie betreiben. Nietzsche gegen Kant, Trawny gegen den Heidegger Kritiker Faye, Wallat gegen die negative Metaphysik von Haag.
Zum Schluss
Die vorwurfsvolle Frage von Wallat an Haag, wieso er „sein ganzes Leben einer einzigen (?) Fragestellung“ gewidmet hat (S. 12), kann niemand für Haag beantworten. Aber das sie nötig ist zu beantworten, ist nicht eine Frage des individuellen „existenziellen Bedürfnisses“, sondern eine Frage des Überlebens der realen Menschheit. Karl Heinz Haag beantwortet sie als objektive der Vernunft im Kampf gegen das kapitalistische System. Gegen die traditionelle Ontologie und gegen den Empirismus sagt er: „In solcher Frontstellung zu den Hauptströmungen der abendländischen Philosophie statuiert Kants negative Metaphysik für das konkrete Tun der Menschen: es ist nur dann wirklich human, wenn es seinen personalen Träger primär als Zweck an sich selbst und niemals bloß als Mittel behandelt. Mit dieser Maxime ist die subjektive Bedingung benannt, die es ermöglicht, die Menschen aus ihrem verdinglichten Dasein zu befreien.“ (Haag: Fortschritt in der Philosophie, S. 200) Mit diesem Zitat des moralischen Gesetzes von Kant erledigt sich auch die falsche Kritik an Haag, „das Verhältnis dieser negativen Metaphysik zur Moralphilosophie“ bliebe „ungeklärt“ (S. 3).
Literatur
Gaßmann, Bodo: Die Negation der praktischen Vernunft als Negation der kritischen Theorie. Ein Kommentar zu dem Kant-Modell „Freiheit. Zur Metakritik der praktischen Vernunft“ aus der „Negativen Dialektik von Adorno. Schriften des Dialektikvereins zu Problemen der Ethik 4, Garbsen 2021. (Kritik an der Historisierung des Denkens)
Gaßmann, Bodo: Vom kritischen Theoretiker zum Kanzler-Berater. Ein Nachruf anlässlich des Todes von Oskar Negt.
(http://www.erinnyen.de/aktuelles/aktuell25.html vom 09.02.2024)
Gaßmann, Bodo: Kritische Anmerkungen zu Hannah Arendt. Phänomenologische Pseudokonkretheit, reaktionäre Ideologie und ethischer Nihilismus. Schriften des Dialektikvereins zu Problemen der Ethik I. 2. überarbeitete und stark erweiterte Auflage, Garbsen 2022. (Mit einer Nietzsche- und Heidegger-Kritik)
Haag, Karl Heinz: Der Fortschritt in der Philosophie, Ffm. 1983.
Kuhne, Frank: Selbstbewußtsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. Über Möglichkeiten und Grenzen der Transzendentalphilosophie. Paradeigmata 27, Hamburg 2007.
Marx/Engels/Werke (MEW), Berlin 1966 ff.
Marx: Das Kapital I /K I (MEW 23)
Marx: Das Kapital III (K III) (M’EW 25)
Negt, Oskar: Politische Philosophie des Gemeinsinns. Band 2. Moral und Gesellschaft: Immanuel Kant, Göttingen 2020. (Mit einem Nachwort von Wallat)
Nietzsche, Friedrich: Werke IV. Aus dem Nachlaß der Achtzigerjahre. Briefe (1861-1889). Herausgegeben von Karl Schlechta, Ffm., Berlin, Wien 1979. (Teile daraus auch als „Willen zur Macht“ erschienen)
Weiß, Volker: Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes, Stuttgart 2017.
Zurück zum Anfang
|
Weitere Internetseiten und unsere Internetpräsenz im Detail:

Audios, Fotos und Videos:
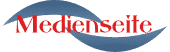
Die letzten Ausgaben der Erinnyen können Sie kostenlos einsehen oder herunterladen:

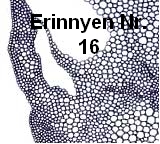
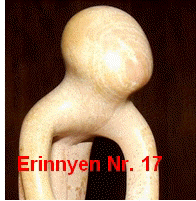
Erinnyen Nr. 18
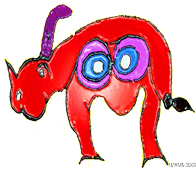
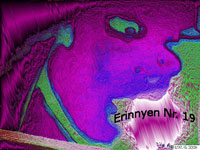

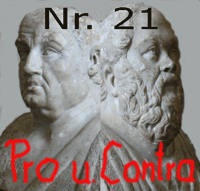
Erinnyen Nr. 22

Erinnyen Nr. 23

Nachrichten aus dem beschädigten Leben:

Unsere Zeitschrift für materialistische Ethik:

Unsere Internetkurse zur Einführung in die Philosophie:

Unsere Selbstdarstellung in Englisch:

Die Privatseite unseres Redakteurs und Vereinsvorsitzenden:

Unser Internetbuchladen:



|