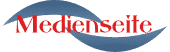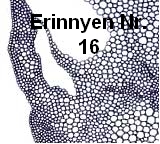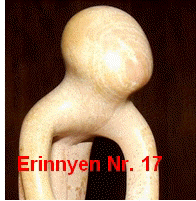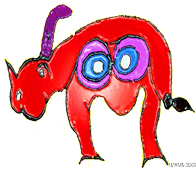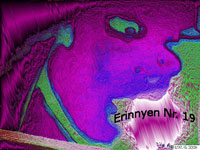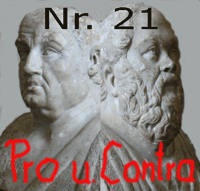|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Grundsätzliches zur Der Unterschied zwischen wissenschaftlicher Analyse und interessengeleitetes, d. h. partikulares, Denken, ist die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung. „(...) und alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen“ (Marx: K III, S. 825). Dagegen wird die interessegeleitete Ökonomiewissenschaft diesem Anspruch nicht gerecht. Marx nennt sie Vulgärökonomie. „Die Vulgärökonomie tut in der Tat nichts, als die Vorstellungen der in den bürgerlichen Produktionsverhältnissen befangenen Agenten dieser Produktion doktrinär zu verdolmetschen, zu systematisieren und zu apologisieren. Es darf uns also nicht wundernehmen, daß sie gerade in der entfremdeten Erscheinungsform der ökonomischen Verhältnisse, worin diese prima facie abgeschmackt und vollkommene Widersprüche sind (...), wenn gerade hier die Vulgärökonomie sich vollkommen bei sich selbst fühlt und ihr diese Verhältnisse um so selbstverständlicher erscheinen, je mehr der innere Zusammenhang an ihnen verborgen ist, sie aber der ordinären Vorstellung geläufig sind." (Ebd.) An anderer Stelle heißt es zur Vulgärökonomie in Bezug auf die Grundrente: „Das Verhältnis eines Teils des Mehrwerts, der Geldrente – denn das Geld ist der selbständige Ausdruck des Werts – zum Boden ist an sich abgeschmackt und irrationell; denn es sind inkommensurable Größen, die hier aneinander gemessen werden, ein bestimmter Gebrauchswert, Bodenstück von soundso viel Quatratfuß auf der einen Seite, und Wert, speziell Mehrwert auf der andern.“ (K III, S. 787) Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis, Durchschnittsarbeitszeit, die in einem Produkt steckt, kein Stück Natur; Boden aber ist ein Stück Natur. Ein Stück Natur mit einem Wert bzw. Preis zu belegen wie bei der Grundrente ist also ein absoluter Widerspruch. Weiter heißt es bei Marx: „Die Vermittlungen der irrationalen Formen, worin bestimmte ökonomische Verhältnisse erscheinen und sich praktisch zusammenfassen, gehen die praktischen Träger dieser Verhältnisse in ihrem Handel und Wandel jedoch nichts an; und da sie gewohnt sind, sich darin zu bewegen, findet ihr Verstand nicht im geringsten Anstoß daran. Ein vollkommner Widerspruch hat durchaus nichts Geheimnisvolles für sie. In den dem innern Zusammenhang entfremdeten und, für sich isoliert genommen, abgeschmackten Erscheinungsformen fühlen sie sich ebenfalls so zu Haus wie ein Fisch im Wasser. Es gilt hier, was Hegel mit Bezug auf gewisse mathematische Formeln sagt, daß, was der gemeine Menschenverstand irrationell findet, das Rationelle, und sein Rationelles die Irrationalität selbst ist.“ (Marx: K III, S. 787) Marx hatte (mit Engels) noch in der „Deutschen Ideologie“ behauptet, dass alles Interesse das einer Klasse sei, hier in Bezug auf die Bourgeoisie (MEW 3, S. 47, 48), so geht der „reife“ Marx der Kapitalanalyse davon aus, dass Wissenschaft nicht auf partikularen Interessen beruht, sondern auf dem allgemeinen Interesse des Subjekts „die Menschheit“ (MEW 42, S. 21), d. h. auch nicht auf den partikularen Interessen des Proletariats. Dagegen steht die „Wissenschaft“, die von partikularen Interessen geleitet wird, wie die bürgerliche „Vulgärökonomie“ der Bourgeoisie: „Es handelte sich jetzt (1873, BG) nicht mehr darum, ob dies oder jenes Theorem wahr sei, sondern ob es dem Kapital nützlich oder schädlich, bequem oder unbequem, ob polizeiwidrig oder nicht. An die Stelle uneigennütziger Forschung trat bezahlte Klopffechterei, an die Stelle unbefangener wissenschaftlicher Untersuchung das böse Gewissen.“ (Marx: K I, S. 21) Wenn Marx die kapitalistische Produktionsweise nach diesen intendierten Prinzipien untersuchen will, dann gilt nicht nur das Menschheitsinteresse, dass die menschlichen Subjekte nicht zum bloßen Mittel der Akkumulation des Kapitals werden (K I, S. 621), sondern immer auch „Selbstzweck“ sein sollen (K III, S. 828). (Das entspricht der zweiten Gestalt des moralischen Gesetzes oder Imperativs von Kant (vgl. Kant: GMS, S. 61).) Wenn die Ökonomietheorie rational nach den wissenschaftlichen Standards sein soll, dann darf sie nicht widersprüchlich konstruiert sein. Zwar gilt aufgrund der gesamtgesellschaftlichen ungeplanten Produktionsweise und der Anarchie des Marktes, dass die Gesetzmäßigkeiten und Regeln dieser Ökonomie „nur als blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit“ sich durchsetzt (K I, S. 117). Und generell gilt: „Es ist überhaupt bei der ganzen kapitalistischen Produktion immer nur in einer sehr verwickelten und annähernden Weise, als nie festzustellender Durchschnitt ewiger Schwankungen, daß sich das allgemeine Gesetz als die beherrschende Tendenz durchsetzt.“ (K III, S. 171) Aber das darf nicht davon abhalten, die Bestimmungen dieser Ökonomie und ihre Gesetzmäßigkeiten sachlich widerspruchsfrei zu konstruieren. Zum Problem der Grundrente Grundlage der Marxschen Analyse der Ökonomie ist die Wertanalyse bis zum Kapital als sich selbst verwertender Wert und den Erscheinungen dieser Ökonomie. Wert oder Tauschwert wird gebildet durch „gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“ oder Durchschnittsarbeit, um ein Produkt herzustellen (abstrakte Arbeit). (Vgl. K I, S. 53) Als Tauschwert haben die Produkte nur verschiedene Quantität, „enthalten also kein Atom Gebrauchswert“ (a. a. O., S. 52). Dagegen hatte bereits Böhm-Bawerk (1896) eingewandt: „Marx habe (...) ‚bei der Suche nach dem Tauschwerte zu Grunde liegenden Gemeinsamen‘ diejenigen ‚tauschwerten Güter, die nicht Arbeitsprodukte sind‘, von vornherein ausgeschlossen. Das sei eine methodische Todsünde‘.“ (Böhm-Bawerk, zitiert nach Kuhne: Marx und Kant, S. 274) Marx selbst hat das Problem gesehen und seine Lösung auf die Erörterung der Grundrente verschoben (MEW 13, S. 48). Voraussetzung der absoluten Grundrente, der notwendige Bedarf, z. B. nach Korn, ist derart angestiegen, dass es die Bebauung vorher unproduktiver Böden (A) profitabel erlaubt.
Zur Grundrente und Durchschnittsprofitrate schreibt Kuhne: „Das private Grundeigentum tritt dem Kapital als ‚fremde Macht und Schranke‘ gegenüber, indem es verhindert, dass der agrikole Mehrwert in den Ausgleich der besonderen Profitraten aller Produktionssphären zur allgemeinen Profitrate eingeht. Die Differenz beider eignet sich das Grundeigentum als absolute Rente an.“ (Kuhne, a. a. O., S. 278) Es bleibt noch das Problem zu klären, weshalb die Produktivität in der Landwirtschaft niedriger ist als etwa in der Industrie, obwohl auch die Landwirtschaft immer mehr technisiert wird. Meine Vermutung: Landmaschinen können meist nur saisonal eingesetzt werden, die Bearbeitung des Bodens und die Ernte sind von Wetterbedingungen abhängig. Das heißt, auch wenn der Grad der Technisierung in der Landwirtschaft einen hohen Stand erreicht hat, sodass immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten müssen, bleibt die Produktivität hinter der verarbeitenden Industrie zurück, also ist auch der individuelle Wert größer als die durchschnittliche Arbeitszeit, die auf vergleichbare Produkte angewandt werden muss. Der größere individuelle Wert geht aber nicht in die allgemeine Profitrate ein, weil der Grundherr die Differenz zwischen Produktionspreis und individuellem Wert (Surpluswert) abschöpft. Literatur Marx wird nach der MEW zitiert; K I ist MEW 23; K III ist MEW 25; Deutsche Ideologie in MEW 3).
Eine Tabelle zur Entwicklung der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft: Beschäftigungszahl in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei in 1000:
(Quelle: Statistisches Bundesamt, zitiert nach: Klassengesellschaft, S. 74)
|
Unser Internetbuchladen:
|
|||||||||||||||||||||||
|
© Copyright: Alle Rechte liegen bei den Erinnyen. Genaueres siehe Impressum. Letzte Aktualisierung: 26.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||